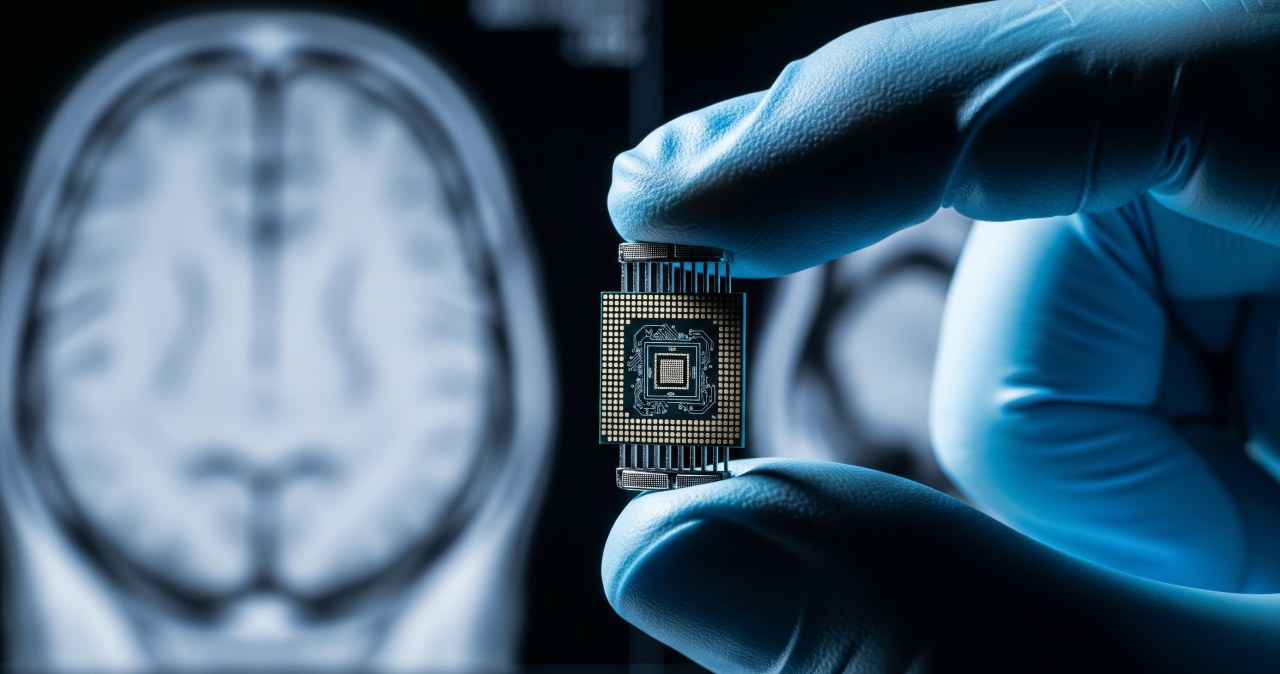Was die Westverschiebung Polens für das Leben und Heimatempfinden meiner Großeltern bedeutet hat, habe ich bereits im ersten Artikel über meine Familiengeschichte behandelt. Doch wie prägen mentale Grenzen, die oft mit geografischen einhergehen, unser Gefühl von Zugehörigkeit und Identität? Und warum sind persönliche Geschichten im historischen Kontext überhaupt so wichtig? Ein erneuter Blick auf das Schicksal einer Familie der deutschen Minderheit in Oberschlesien.
Die Frage nach Heimat ist eine, die in der Geschichte der deutschen Minderheit in Schlesien häufig aufkommt. Das Konzept von Heimat wiederum ist eng verbunden mit Grenzen: geografischen sowie mentalen Grenzen, dem Eingrenzen und Ausgrenzen bestimmter Gruppen sowie dem Verschieben von nationalen Grenzen, beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch heute spielen Grenzen eine wichtige Rolle beim Zugehörigkeitsempfinden und sind keineswegs fest und unveränderlich, wie Kriege, Grenzgebiete sowie Kriege in Grenzgebieten weltweit zeigen.
Übers Ein- und Ausgrenzen
Meine Familie väterlicherseits stammt aus der Woiwodschaft Oppeln und gehört zu den deutschen Spätaussiedlern. Mein Urgroßvater Robert, geboren 1914, diente im Krieg als Reiter. Bei der Kapitulation Deutschlands war er gerade in Jugoslawien und geriet in englische sowie amerikanische Gefangenschaft. Nach seiner Entlassung arbeitete er in Bamberg bei der Eisenbahn. Nachdem er einen Brief von seinem Vater bekommen hatte, entschied er sich, über die Grenze nach Oberschlesien zu fahren, um seine Frau Elisabeth und seinen Sohn mit nach Deutschland zu nehmen. Kurz nachdem er jedoch mit dem Zug über die Grenze gefahren war, schloss die US-Besatzung diese. Zurück in Oberschlesien musste mein Urgroßvater sich dann zwei Jahre lang auf einem Heuboden verstecken, da ein Cousin von ihm Aufseher in einem Arbeitslager war und ihn suchte, um ihn umzubringen.
Die Zeit im Krieg blieb für meinen Urgroßvater auch Jahrzehnte später ein prägender Teil seines Lebens. So sehr, dass das einzige Gesprächsthema, das zwischen ihm und meinem Vater je wirklich aufkam, erst dann entstand, als mein Vater selbst einige Jahre bei der deutschen Bundeswehr gedient hatte. Es mag schwer nachvollziehbar sein, wie mein Urgroßvater sich mit der Wehrmacht identifizieren konnte – doch für ihn war es eine wichtige Aufgabe, ein zentraler Bestandteil seines Lebens. Zugehörigkeit ist schließlich auch ein Gefühl, das durch Nationalität, ethnische und soziale Identität geprägt wird.
 Meine Urgroßeltern bei ihrer Hochzeit im Februar 1942
Meine Urgroßeltern bei ihrer Hochzeit im Februar 1942Quelle: Victoria Matuschek
Das Leben in Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg sah plötzlich ganz anders aus als vorher. Die deutsche Bevölkerung galt vielerorts als Freiwild. Wie Andreas Kossert in seinem Buch „Kalte Heimat: Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945“ schreibt, war sie im Grunde schutzlos der ‚Rache der Opfer‘ ausgeliefert – eine Vergeltung, die selbst jene traf, die sich gegen das NS-Regime aufgelehnt oder unter ihm gelitten hatten. Neben der Vertreibung aus ihren Häusern waren in den besetzten Gebieten Plünderungen, Erschießungen und Vergewaltigungen an der Tagesordnung. Zahlreiche Deutsche – ebenso wie Polinnen und Polen – wurden in polnische Internierungs- und Arbeitslager verschleppt. Von den insgesamt 700.000 Gefangenen überlebte fast die Hälfte die Haft nicht.
Auch die Mutter meiner Urgroßmutter Franziska Bugiel war mit meinem damals dreijährigen Großvater zeitweise im Gefangenenlager in Blottnitz im Kreis Groß Strehlitz. Während meine Urgroßmutter, ihr Vater und ihre Geschwister auf dem Feld arbeiteten, sangen und tanzten, passte Franziska auf ihren Enkel auf und wurde, ebenso wie andere Bewohner Porembas, abtransportiert. Mehrere Wochen waren sie in dem Gefangenenlager und konnten nur durch ein Gitter mit ihrer Familie sprechen, die wöchentlich zu Besuch kam. Ein äußerst einschneidendes Erlebnis für Franziska war, dass ein Russe ihr im Lager anbot, meinen Großvater gegen eine Mauer zu werfen, damit sie nicht mehr mit dem kleinen Kind belastet sein würde…
Ich frage mich, was meine Ururgroßmutter in diesem Lager alles erlebt hat. Welche Grausamkeiten hatte sie wohl gesehen? Und wo begegnete ihr Gnade? Ich kenne nur wenige Details über ihre Zeit im Gefangenenlager und weiß, dass sie und mein Großvater überlebten. Doch bei all den Berichten über die Nachkriegslager, in denen Hunger, Kälte, Krankheit, Vergewaltigung und Tod allgegenwärtig waren, entsteht ein düsteres Bild.
Mein Großvater spricht gar nicht über diese Zeit. Vielleicht kann er sich nicht erinnern, vielleicht hat er seine Erinnerungen aber auch verdrängt, um nach vorne schauen zu können. Doch das Verdrängte verschwindet nie ganz: Man trägt es immer noch in sich. Verschiedene psychologische Studien belegen, dass (Nach-)Kriegstraumata über mehr als drei Generationen hinweg weitergegeben werden können. Krieg und Vertreibung bleiben deshalb nicht nur historische, sondern noch immer auch aktuelle Themen.
Aber können wir wirklich von Tätern und Opfern sprechen? Sowohl im Holocaust als auch in den Nachkriegslagern zeigt sich deutlich, dass es nicht die ‚guten‘ Juden oder Polen und ‚bösen‘ Deutschen – oder umgekehrt – gibt. Die Geschichte scheint sich immer wieder zu wiederholen: Mal sind die einen die ‚Täter‘ und ‚Täterinnen‘, mal die anderen. Rache und Vergeltung führen nur zu einer endlosen Wiederholung des Zyklus: „Auge um Auge“… und alle sind blind.
 Mein Urgroßvater in Uniform
Mein Urgroßvater in UniformQuelle: Victoria Matuschek
Über mentale Grenzen
Meine Urgroßeltern konnten sich mit der Westverschiebung Polens wohl nie wirklich abfinden. Für sie waren die Polinnen und Polen die ‚Ausländer‘ und die einstige Heimat war plötzlich zu einer ‚falschen Heimat‘ geworden. Da die Mehrheit der schlesischen Bevölkerung die Region verließ, sahen sich die verbliebenen Familien mit tiefgreifenden Veränderungen in ihrer vertrauten Umgebung konfrontiert, verursacht durch die Zuwanderung und das veränderte politische System. Ihre Sesshaftigkeit wurde meiner Familie letztlich zum Verhängnis: Obwohl sie ihr Haus behalten konnten, das sie allerdings einige Zeit mit einer polnischen Familie teilen mussten, entstanden soziale sowie mentale Ausgrenzungen.
Schlesierinnen und Schlesier wurden häufig als ‚unechte Polen‘ oder ‚falsche Deutsche‘ bezeichnet, da sie weder vollständig in die polnische noch in die deutsche Identität eingegliedert waren. Ihre kulturellen und sprachlichen Unterschiede sowie ihre komplexe historische Zugehörigkeit führten zu einer Grenzposition zwischen den Nationen. Die mentalen und geografischen Grenzen machten die Deutschen, die in Schlesien geblieben waren, zu ‚Fremden‘ in ihrer eigenen Heimat. Die Kultur vor Ort geriet zunehmend in den Schatten der neuen nationalen Grenzen.
Auch wenn meine Familie noch einige Zeit in Schlesien lebte, ist es nicht überraschend, dass sie schließlich ihren ursprünglichen Heimatort verließ, um nach Deutschland auszuwandern – oder, aus ihrer Sicht, ‚zurückzukehren‘.
 Meine Urgroßmutter mit meinem Großvater
Meine Urgroßmutter mit meinem GroßvaterQuelle: Victoria Matuschek
Grenzen als Räume
Polen wurde in seiner Geschichte insgesamt fünfmal aufgeteilt oder grundlegend verschoben: mehrfach im 18. Jahrhundert sowie während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Kaum eine Region hat eine derart heterogene Grenzgeschichte wie Schlesien. Kein Wunder also, dass Grenzen jeglicher Art ein guter Anhaltspunkt sind, um die Zugehörigkeit in Schlesien zu beschreiben und zu verstehen. Dabei sollte man Grenzen nicht nur als Einschnitte denken, die das ‚Eigene‘ vom ‚Fremden‘ trennen, sondern auch als mehrdeutige, heterogene Konstrukte, die Raum für Andersartigkeit und Freiheit schaffen.
Etymologisch betrachtet stammt das Wort „Grenze“ im Deutschen vom Altpolnischen „granica, grańca“ (Grenzzeichen, Grenzlinie). Christiane Hoffmann verweist in ihrem Roman „Alles, was wir nicht erinnern: zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“ darauf, dass im Polnischen das Wort „granica“ ursprünglich nicht auf eine Linie, sondern auf einen Raum referiert habe, nämlich auf das Grenzgebiet mit seinen fließenden Übergängen von Sprache, Kultur, Religion und Herrschaft.
Nicht nur sprachlich ist dieses Wort vielfältig, sondern es eröffnet auch ein breites semantisches Feld. Eine Grenze kann trennen und gleichzeitig verbinden – so z. B. in dem Dreiländereck, wo Polen, Deutschland und Tschechien aufeinandertreffen. Dort ist die Grenze nicht nur eine Linie, sondern ein Raum – sowohl geografisch als auch mental.
 Meine Urgroßmutter, geboren 1923, und ich, 2006
Meine Urgroßmutter, geboren 1923, und ich, 2006Quelle: Victoria Matuschek
Grenzen einreißen, Brücken bauen
Die Gedächtnisforschung hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem breit gefächerten, interdisziplinären und internationalen Forschungsfeld entwickelt. Erinnerung spielt dabei eine zentrale Rolle – kulturell, global und wissenschaftlich. „Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben“, war ein Satz, der in meinem Studium oft erwähnt wurde. Umso wichtiger sind individuelle Erinnerungen, die neue und alternative Perspektiven eröffnen können. Persönliche Geschichten, besonders die unserer Vorfahren, helfen uns, historische Ereignisse besser zu verstehen und einzuordnen.
Es ist wichtig zu wissen: Wir können nicht über Geschichte, über Politik sprechen, wenn wir die persönliche Sphäre außer Acht lassen. Und wir können nicht über die persönliche Sphäre sprechen, ohne dass Politik und Geschichte eine Rolle spielen.
Auch Theorien zu kultureller Identität und Zugehörigkeitsempfinden haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend aus individuellen Perspektiven und Erfahrungen heraus entwickelt. Ein Beispiel dafür ist die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin afroamerikanischer Abstammung bell hooks, die Marginalität als einen Raum radikaler Freiheit versteht.
Wir können Geschichte und Politik nicht getrennt von der persönlichen Sphäre betrachten – sie beeinflussen sich gegenseitig.
Marginalität oder auch die Existenz am Rande einer sozialen Gruppe oder Klasse wird als ein Ort beschrieben, der den Marginalisierten gehört. Ihre zweiseitige Perspektive entsteht durch die Position am Rand, die es den Marginalisierten ermöglicht, sowohl die Perspektive der dominierenden Gruppe als auch ihre eigene Sichtweise zu verstehen und zu hinterfragen. Dadurch gewinnen sie die Fähigkeit, politische und kulturelle Freiheit zu erlangen und selbstbestimmt zu handeln.
Diese Identifikation ermöglicht es Grenzgängerinnen und -gängern, die ihnen häufig zugeschriebene Opferrolle abzulehnen und ihre kritische, zwischen den Kulturen liegende Position zu nutzen, um kreative Potenziale zu entfalten. Sie entwickeln multiple Identitäten, indem sie verschiedene Kulturen und Gemeinschaften gleichzeitig annehmen, und können so die Grenzen zwischen Kulturen und Nationen auflösen.
Das dekolonisierende Denken von bell hooks verändert auch das Verständnis von Heimat: Heimat ist kein festgelegter, physischer Ort, sondern ein dynamisches Konzept, das sich durch Erfahrungen, Beziehungen und kulturelle Praktiken ständig verändert. Heimat ist nicht nur ein Rückzugsort, sondern auch ein Ort des Widerstands und der Transformation, der in der Vielfalt von Orten und Perspektiven entsteht. In diesem Verständnis wird Heimat zu einem Raum der Freiheit, in dem neue Welten und alternative Realitäten geschaffen werden können.
Ebenso Grenzpositionen, wie die der Schlesierinnen und Schlesier, sind sowohl Orte der Unterdrückung als auch des Widerstands, die Entfremdung erfahren lassen, aber auch Raum für Umdenken bieten. Heimat ist somit nicht nur ein Ort der Vergangenheit oder Herkunft, sondern ein Raum der kritischen Reflexion und kreativen Gestaltung einer neuen Zukunft. Ein Raum, der für alle zugänglich ist, die sich eine Identifizierung jenseits von Stereotypen, wie ‚unechte Polen‘ oder ‚falsche Deutsche‘, wünschen.
Victoria Matuschek