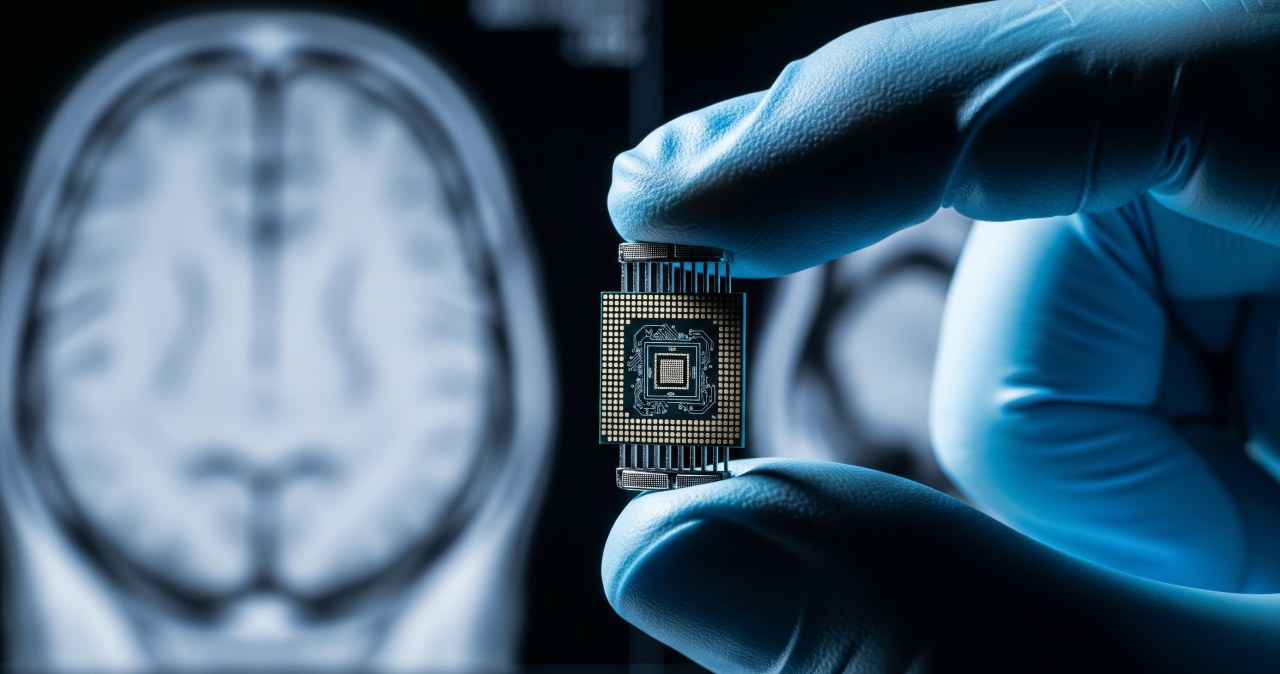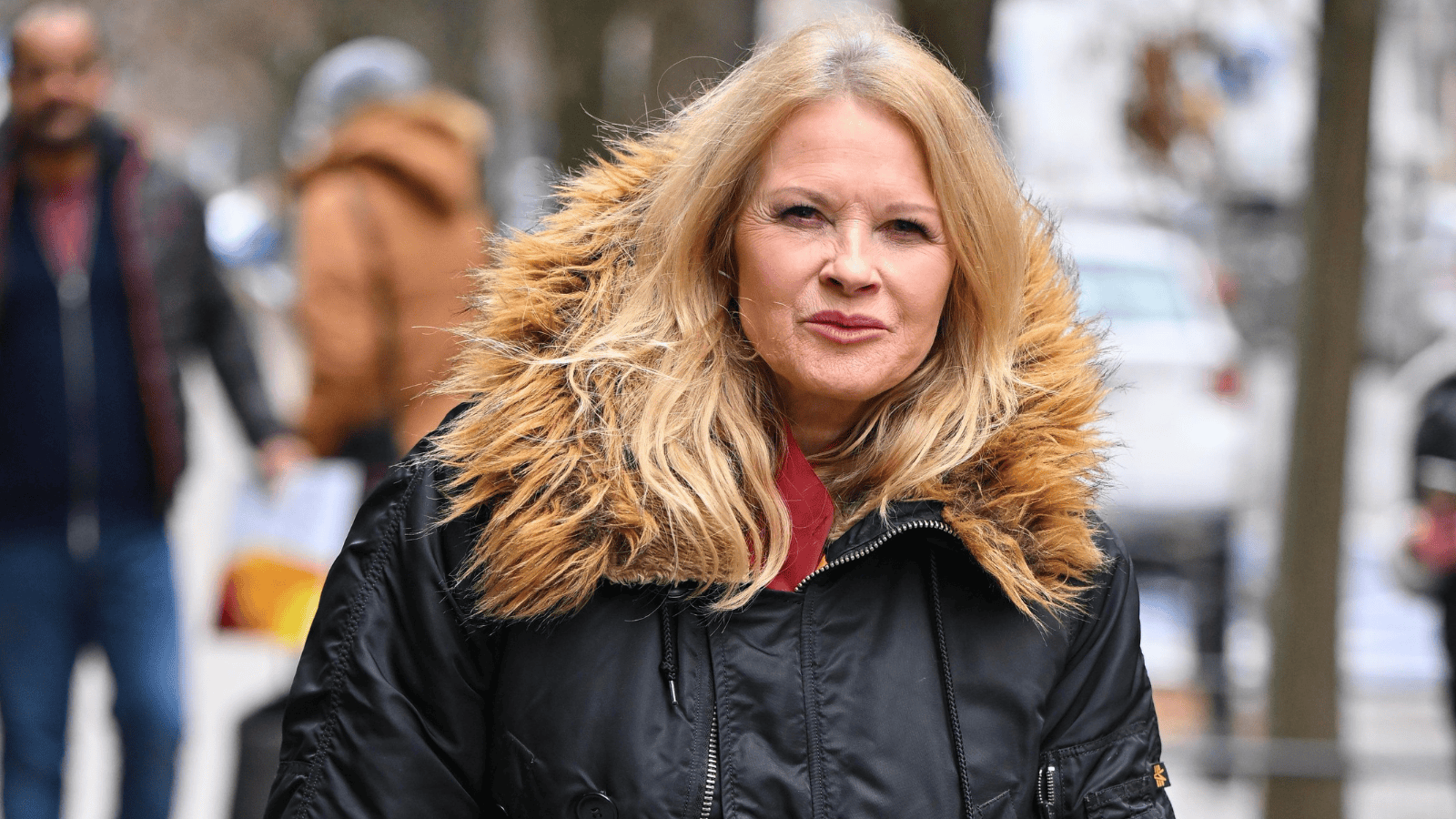28. Sonntag im Jahreskreis – C
1.Lesung: 2 Kön 5,14–17
2. Lesung: 2 Tim 2,8–13
Evangelium: Lk 17,11–19
Geschenktes, Dankbarkeit und Menschlichkeitsverlust
Wir mögen es, beschenkt zu werden. Geschenke anzunehmen ist angenehm. Erhalten wir etwas, was wir uns sehr wünschen, sind wir erfreut und wenigstens für wenige Augenblicke (oder auch länger) sehr glücklich. Das, was wir haben, das, wie wir leben dürfen, das, was unseren Lebenskomfort ausmacht, nehmen wir oft als selbstverständlich an. Nicht selten begleitet uns die innere Überzeugung: „Das gehört sich so“, „Ich habe Anspruch darauf“, „Das steht mir zu“, „Ich soll es zuerst bekommen“.
„Wer nur das haben will, worauf er glaubt, Anspruch zu haben, verliert dabei etwas wesentlich Menschliches: die Fähigkeit, sich beschenken zu lassen und zu danken.”
Jörg Heidig (geb. 1974), Prozesspsychologe, schreibt: „Ein interessanter Blickwinkel auf das Leben bietet sich, wenn man es als Muster aus «Geben» und «Nehmen» betrachtet. Stark vereinfachend könnte man sagen, dass man als Kind und in der Jugend vor allem nimmt und weniger gibt. Auch während man ausgebildet wird, studiert, ausprobiert o. Ä., ist man eher beim Nehmen als beim Geben.“
Ist ständiges, unkritisches Nehmen nicht in gewisser Weise ein Verlust der Menschlichkeit?
Geschenktes bedenkenlos nehmen?
Gehen wir auf den Abschnitt aus dem Evangelium nach Lukas ein, der in den katholischen Kirchen am 28. Sonntag im Jahreskreis gelesen wird. Dort begegnen wir dem Geben und Nehmen. Lesen wir diesen Text gemeinsam:
„Es geschah auf dem Weg nach Jerusalem: Jesus zog durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!
Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern! Und es geschah: Während sie hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter.“
Aus der Perspektive der Bibel war er ein Fremder. Die Juden pflegten keine Beziehungen zu den Samaritern. Das hatte religiöse Gründe. Die Samariter glaubten zwar an den einen Gott Israels, standen jedoch nicht in Verbindung mit dem Tempel am Berg Zion in Jerusalem, sondern mit dem eigenen Heiligtum am Berg Garizim, in der Nähe des biblischen Sichem in Samarien.
Zu Zeiten Jesu galten sie für die Juden als irregeführte Abtrünnige. Der Geringgeschätzte bedankte sich. Die neun Selbstherrlichen nahmen die Heilung durch Jesus als etwas Gegebenes an, das ihnen zusteht. Bedenkenlos zogen sie weiter in ihren Alltag hinein. Sind wir in manchen Fällen auch nicht davon belastet?
Wie geht es uns mit dem Geben und Nehmen?
Wir alle sind beschenkt. Die Natur ist ein Geschenk. Die Erde, als gut ausgestattete Lebensumgebung, wurde uns von Gott gegeben. Das menschliche Leben hat seinen Ursprung in Gott. Unsere Eltern haben uns – unabhängig davon, wie es dazu kam – das Leben geschenkt und uns mehr oder weniger geschickt versorgt und (in vielen Fällen) versorgen sie uns immer noch.
Durch gute Zusammenarbeit mit anderen Menschen erfahren wir, wie sehr wir einander benötigen. Das Schott-Messbuch auf tagesimpuls.de kommentiert:
„Jeder Mensch braucht die Hilfe anderer, um leben zu können. Wird sie ihm verweigert, so spricht man von Unmenschlichkeit. Wer aber nur das und all das haben will, worauf er glaubt, Anspruch zu haben, verliert dabei selber etwas wesentlich Menschliches: die Fähigkeit, sich beschenken zu lassen und zu danken. Gerade das Wertvollste – das Leben selbst und die Liebe – kann uns nur geschenkt werden.“
Bleiben wir nur auf uns bezogen, denken und leben wir egoistisch, verlieren wir unsere Mitmenschlichkeit, die zu unserem Dasein gehört. Unser Leben besteht aus Nehmen und Geben, aus Dankbarkeit und Großzügigkeit. Nur so sind und werden wir menschlich. Lassen wir uns dies vom egoistischen, eingeengten Denken und Handeln nicht verderben.