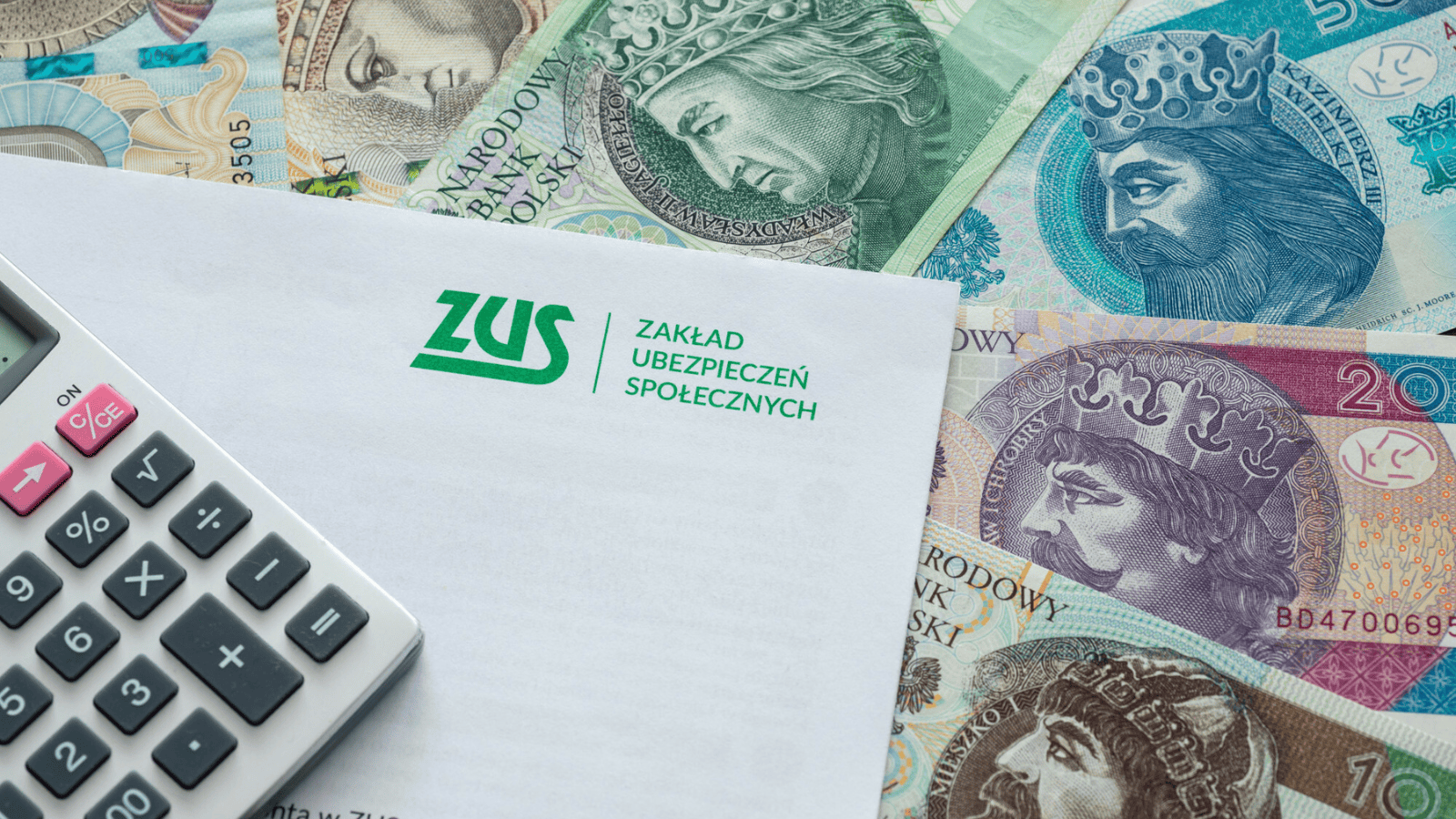Über Care-Arbeit, Überlastung und gesellschaftliche Erwartungen
Wie viel kostet es, wenn eine Mutter täglich unsichtbare Arbeit leistet, die niemand sieht und kaum jemand anerkennt? 12 Milliarden Stunden unbezahlte Care-Arbeit leisten Frauen weltweit jeden Tag – eine unfassbare Menge Lebenszeit und Energie, die in unserer Gesellschaft oft als selbstverständlich gilt. Mareike Fallwickls Roman „Die Wut, die bleibt“ erzählt die Geschichte von Helene, einer Mutter, die im Lockdown an der Überforderung zerbricht. Ihr Schicksal steht stellvertretend für viele Frauen, die täglich unter der Last der Care-Arbeit und gesellschaftlicher Erwartungen an ihre Grenzen stoßen.
 Moderatorin Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik von der Universität Oppeln heißt die Autorin Mareike Fallwickl herzlich willkommen.
Moderatorin Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik von der Universität Oppeln heißt die Autorin Mareike Fallwickl herzlich willkommen.Foto: Victoria Matuschek
Eine Lesung, die bewegt
Am 13. Mai präsentierte die Österreich-Bibliothek in Oppeln im Rahmen des 25. Österreichischen Frühlings den Roman „Die Wut, die bleibt“ in einer eindrucksvollen Lesung mit der österreichischen Autorin Mareike Fallwickl, moderiert von Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik vom Institut für Literaturwissenschaft der Universität Oppeln. Zu den Gästen zählten Sandra Cierniak vom Konsulat in Oppeln sowie Monika Wittek, ehemalige Kulturbeauftragte des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG).
Fallwickl beginnt ihren Roman mit einer Szene, die unter die Haut geht: Helene, Mutter von drei Kindern, nimmt sich während des Lockdowns das Leben. Was als literarische Zuspitzung gedacht war, erwies sich als bittere Realität für viele: „Mir haben später Frauen geschrieben: Ich bin Helene. Ich habe versucht, mich im Lockdown umzubringen. Es gab auch Männer, die schrieben: Meine Frau hat sich umgebracht.“, so die Autorin. Die Erschöpfung von Müttern ist nicht nur Fiktion – sie ist Alltag.
Der Lockdown wirkte dabei wie ein Brennglas für Probleme, die schon lange existierten: Die Überlastung von Müttern, die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit und die gesellschaftlichen Erwartungen waren auch schon vor der Pandemie Realität – sie wurden in dieser Zeit lediglich spürbarer denn je.
 Die Autorin hat bereits sieben Werke veröffentlicht. Ihr Buch „Die Wut, die bleibt“ wurde 2022 veröffentlicht.
Die Autorin hat bereits sieben Werke veröffentlicht. Ihr Buch „Die Wut, die bleibt“ wurde 2022 veröffentlicht.Foto: Victoria Matuschek
Care-Arbeit: Das unsichtbare Fundament unserer Gesellschaft
Care-Arbeit ist weit mehr als Kinderbetreuung oder Haushalt – sie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Besonders sichtbar wird das im Gesundheitswesen und in der Pflege, wo zwischen 70 und bis zu 95 Prozent der Beschäftigten Frauen sind. „Das ist der größte Bereich, den wir in Fürsorge überhaupt haben, und er ist wahnsinnig weiblich besetzt“, erklärt Mareike Fallwickl. Frauen tragen dieses ganze System – und das in einem Bereich, der oft besonders ausbeutend und ungerecht ist.
Diese Überlastung ist kein Zufall, sondern ein strukturelles Problem. „Das ganze System beruht auf dieser Care-Arbeit, die Erschöpfung der Frauen ist kein Nebenprodukt, sondern sie ist die Basis unserer kapitalistischen Gesellschaft“, so Fallwickl. Würde diese Arbeit tatsächlich bezahlt und wertgeschätzt, könnte sich unsere Gesellschaft ihren Wohlstand in der aktuellen Form gar nicht leisten.
Weiter erklärt die Autorin: „Frauen arbeiten im Schnitt 98 Stunden pro Woche – das sind zweieinhalb Vollzeitjobs. Sie leiden unter Stresssymptomen, chronischer Erschöpfung, Depressionen, Autoimmunerkrankungen, Angststörungen – und werden mit ihren Beschwerden oft nicht ernst genommen.“ Und sie bringt es noch drastischer auf den Punkt: „Frauen sterben, weil sie so umfassend ausgebeutet werden“.
 Mareike Fallwickl liest Ausschnitte aus ihrem Roman „Die Wut, die bleibt“.
Mareike Fallwickl liest Ausschnitte aus ihrem Roman „Die Wut, die bleibt“.Foto: Victoria Matuschek
Rollenbilder, Fremdbestimmung und die Last der Erwartungen
Fallwickl legt in ihrem Roman offen, wie tief gesellschaftliche Erwartungen und Rollenbilder verankert sind: „Eine Mutter ist eine Mutter ist eine Mutter.“ Von klein auf wird Frauen vermittelt, dass Fürsorge ihr Lebenszweck ist. „Das Weiblichsein ist mit uns ganz eng verknüpft, erstens mit dem Gebären, aber auch mit der Fürsorge.“ Doch diese Fürsorge ist selten selbstbestimmt. Während Männer Aufgaben übernehmen, die flexibel und planbar sind, bleiben Frauen die Tätigkeiten, die sofort und zwingend erledigt werden müssen: Hunger stillen, Hausaufgaben betreuen, emotionale Krisen begleiten.
„Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass Männer fast immer Aufgaben erfüllen, die sehr selbstbestimmt erledigt werden können, während Frauen und Mütter die Dinge tun, die sehr viel mehr Fremdbestimmung und sofortige Erledigung erfordern.“, erklärt die Autorin.
Deutlich wird auch, wie unterschiedlich das Verhalten von Müttern und Vätern gesellschaftlich bewertet wird. Fallwickl formuliert es treffend: „Würde sich auf Seite 1 dieses Buchs ein Vater entziehen, würde es niemand als radikal ansehen. Das Narrativ der abwesenden Väter ist auserzählt.“ Während von Müttern erwartet wird, dass sie immer präsent und aufopfernd sind, gilt die Abwesenheit von Vätern häufig als normal oder sogar als unproblematisch.
Hinzu kommt das Phänomen der „weaponized incompetence“: Männer, die Aufgaben absichtlich schlecht erledigen, um ihnen dauerhaft zu entgehen. „Es gibt eigene Websites, wo Männer sich Tipps geben: Wie kann man eine Aufgabe so dermaßen blöd erledigen, dass man sie nie wieder machen muss?“, erklärt die Autorin. Das Ergebnis: Frauen übernehmen die Arbeit lieber selbst, um Konflikte zu vermeiden.
Wenn Mütter ausbrennen, brennt die ganze Gesellschaft.
Infolgedessen fühlen sich viele Frauen allein gelassen, ihre eigenen Bedürfnisse bleiben unsichtbar. „Ich bin so durch, so fertig mit den Nerven“, diesen Satz hört Fallwickl von Müttern permanent – und die Gesellschaft akzeptiert es als Normalzustand.
Wut als schützende Kraft
Doch die Wut, die aus dieser Überforderung entsteht, ist nicht nur destruktiv – sie kann auch eine wichtige, schützende Funktion haben. Mareike Fallwickl zitiert die Autorin Alexandra Zykunov: „Die Wut ist wie eine große Schwester von dir. Die Wut ist wie eine beste Freundin, die auf dich aufpasst.“
Wut wird oft als negative, unerwünschte Emotion dargestellt, besonders bei Frauen. Doch sie entsteht dann, wenn jemand ungerecht behandelt wird. „Die Wut ist eigentlich jemand, der dir klar macht: Hey, das war nicht richtig. Du darfst deine Stimme erheben, weil mit dir wurde gerade umgegangen, wie es nicht in Ordnung ist.“, führt Fallwickl weiter aus.
Indem Frauen lernen, ihre Wut als Signal für Ungerechtigkeit zu verstehen und zu nutzen, können sie neue Wege finden, sich zu behaupten und Veränderungen anzustoßen. Die Wut wird so von einer verbotenen Emotion zu einer Kraftquelle – und zu einem Motor für gesellschaftlichen Wandel.
 Dieses Jahr erschien die polnische Ausgabe des Romans. Von links nach rechts: Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik, Leiterin der Österreich-Bibliothek Monika Wójcik-Bednarz, Sandra Cierniak und Mareike Fallwickl.
Dieses Jahr erschien die polnische Ausgabe des Romans. Von links nach rechts: Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik, Leiterin der Österreich-Bibliothek Monika Wójcik-Bednarz, Sandra Cierniak und Mareike Fallwickl.Foto: Victoria Matuschek
Wut als Motor für Veränderung
Die Wut, die im Roman spürbar wird, ist vielschichtig: Wut auf sich selbst, auf gesellschaftliche Zwänge, auf das patriarchale System. Sie ist aber eben auch Antrieb für Veränderung. Nach der Lektüre des Buches ist ein österreichischer Politiker zurückgetreten – mit den Worten: „Ich möchte ein anderer Vater für meine Kinder sein.“ Frauen haben sich den Kopf rasiert oder Selbstverteidigungskurse begonnen. Viele haben Lesezirkel gegründet, sich vernetzt und gemeinsam neue Wege gesucht. Jüngst versammelten sich in Berlin 100.000 Mütter am Brandenburger Tor – ebenfalls inspiriert durch das Buch – um laut zu werden und für mehr Sichtbarkeit und Anerkennung von Care-Arbeit zu kämpfen.
Diese Reaktionen zeigen, wie stark das Buch Menschen berührt und zum Nachdenken über die eigenen Rollen, Erwartungen und Handlungsmöglichkeiten anregt oder wie Fallwickl es formuliert: „Ja, Literatur kann auch durchaus etwas bewegen.“
Was bleibt? Fragen, die uns alle angehen
In der heutigen Gesellschaft bleiben jedoch zentrale Fragen offen, die uns alle betreffen und auf die der Roman aufmerksam macht: Wie lange kann eine Gesellschaft funktionieren, wenn die tragenden Säulen – Mütter, Pflegerinnen, Fürsorgende – permanent überlastet und unsichtbar bleiben? Was muss sich ändern, damit Care-Arbeit endlich den Stellenwert erhält, den sie verdient? Wie können Männer und Frauen gemeinsam Verantwortung übernehmen, ohne dass Erschöpfung und Überforderung zum Alltag werden?
Mehr als Wut: Die Kraft der Liebe
Doch bei aller Schwere und Wut bleibt am Ende eine stärkere Kraft, die Fallwickl betont: „Das Hauptthema des Romans ist nicht die Gewalt. Das Grundgefühl zwischen Frauen ist Liebe.“ Es ist der Zusammenhalt, die Solidarität, das Verständnis füreinander, das Frauen und letztlich auch die Gesellschaft trägt.
So zeigt „Die Wut, die bleibt“ eindrucksvoll: Es ist die Liebe, die uns antreibt – und die vielleicht am Ende die Kraft zur Veränderung in sich trägt.
Der Roman „Die Wut, die bleibt“ ist 2025 auf Polnisch unter dem Titel „Wściekłość“ erschienen.
Am letzten Dienstag im Mai um 22:05 Uhr auf Radio Doxa wird ein Interview mit Mareike Fallwickl zu hören sein.
Auf Spotify wird der Podcast mit dem Interview direkt im Anschluss zu hören sein, ebenso auf Youtube unter Media VdG:
Frauenfragen – Babskie Sprawy | Podcast on Spotify
Media VdG – YouTube
Die Werke von Mareike Fallwickl können in der Österreich-Bibliothek in Oppeln ausgeliehen werden:
SOWA OPAC : Katalog centralny WBP w Opolu – Die Wut, die bleibt : Roman
SOWA OPAC : Katalog centralny WBP w Opolu – Das Licht ist hier viel heller : Roman
SOWA OPAC : Katalog centralny WBP w Opolu – Und alle so still : Roman
Polnische Version:
SOWA OPAC : Katalog centralny WBP w Opolu – Und alle so still : Roman




![Świąteczne spotkania sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusów. Eksperci przypominają o znaczeniu szczepień przeciw COVID-19 [DEPESZA]](http://www.newseria.pl/files/1097841585/szczepienia-still-5.jpg)